Wortwechsel · 14. Mai 2025
Integration durch Wohnen: Wie lebt die Generation Migration?
Das war Thema des jüngsten Wortwechsels des Verbandes der Privaten Bausparkassen in Berlin. Mit Bezug auf die gleichnamige Studie des Verbandes wurde dort debattiert: Wie können Politik, Kommunen und Gesellschaft bessere Voraussetzungen für gelingende Integration durch Wohnen schaffen?
Die Wortwechsler:innen



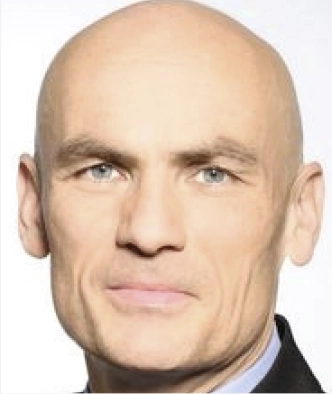
Moderation

„Die öffentliche Debatte in Deutschland kennt nur zwei Pole. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Oder: Deutschland ist kein Einwanderungsland“, so eingangs Christian König, Hauptgeschäftsführer des Bausparverbandes. Mit der Regierungserklärung von Friedrich Merz sei das nun klargestellt worden.
Aber die Debatte sei ideologisch überladen gewesen, werde zumeist polemisch geführt und liefere am Ende keine Antworten auf die Frage: Wie wollen wir hier zusammen leben und wohnen und vor allem die Zukunft gestalten? In solchen Fällen helfe Nüchternheit im Umgang mit der Gegenwart und den Herausforderungen. „Deswegen haben wir diese Studie in Auftrag gegeben. Deren Ergebnisse lassen kaum einen anderen Schluss zu: Wohnen ist ein wichtiger Faktor im Rahmen der Integration.“
Gradmesser Wohneigentumsquote
In den letzten 20 Jahren ist die Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Deutschland um ein Viertel gewachsen. In einigen Großstädten liegt der Anteil bei über 50 Prozent. Im Jahr 2023 lebten hierzulande mehr als 21 Millionen Menschen mit internationaler Familiengeschichte. Das sind Zahlen, die Dr. Daniel Dettling vom Institut für Zukunftspolitik als Autor der Studie dazu nannte, ergänzt um die Feststellung: „Erfolgreich ist eine Politik der Integration dann, wenn sich wichtige Kennzahlen annähern.“ Hier verwies er auf „immer noch gravierende Unterschiede“ bei der Wohneigentumsquote von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund: 35 Prozent bei den einen und 56 Prozent bei den anderen, mithin ein Unterschied von fast 20 Prozent zwischen beiden Bevölkerungsgruppen.
Familien als treibender Faktor
Die neue Trendstudie zeigt nach seinen Worten zugleich auf: Die große Mehrheit der Generation Migration ist zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer aktuellen Wohnsituation. Zwei Drittel der Generation 60+ sind sogar sehr zufrieden. Daran werde deutlich: „Wir haben beim Thema Wohnen und Integration enorme Fortschritte gemacht.“ Ein Trend, der sich abzeichnet: „Die Gruppe der ökonomisch erfolgreichen Migranten und Migrantinnen wird in Zukunft – da sie im Durchschnitt jünger sind als der Bundesdurchschnitt – weiter wachsen.“ Vor allem die jüngere Generation und Familien mit Migrationshintergrund wollen – wie die Studie weiter ergab – im Wohneigentum leben und eine große Mehrheit der Jüngeren in den nächsten zehn Jahren deshalb raus aus der Stadt: an den Stadtrand, in einen Vorort oder aufs Land. Dettlings Fazit: „Das Potenzial für eine neue Politik der Integration durch Wohnen ist enorm und sollte in den nächsten Jahren verstärkt genutzt werden.“
„Hessengeld“ als Vorbild
Ist der Wunsch der Generation Migration nach Wohneigentum erkannt und auf dem Schirm der Politik? Haben wir als Gesellschaft hier Nachholbedarf? Braucht es eigene Programme für die Generation Migration, um Wohneigentum zu erwerben? Welche Instrumente und Maßnahmen haben sich in dieser Hinsicht in der Vergangenheit bewährt? Was wäre der neuen Bundesregierung zu empfehlen? Zu diesen und weiteren Fragen entspann sich auf dem Podium und anschließend auch mit dem Auditorium eine lebhafte Diskussion.
Einig war man sich auf jeden Fall darin: Ein spezielles Förderprogramm sei weder nötig, noch eine richtig gute Idee. empirica-Vorstand Dr. Reiner Braun verband diese Einschätzung zugleich mit deutlicher Kritik an der derzeitigen Bundesförderung und einem Lob für das sogenannte „Hessengeld“, mit dem das Bundesland aktuell als Einziges den Erwerb von Wohneigentum explizit fördere.
Schwellenhaushalte außen vor
Auf Bundesebene gebe es zwar sehr viele Fördertöpfe – „alles große Summen, die als zinsvergünstigte Kredite ausgereicht werden. Aber nichts Vergleichbares wie Baukindergeld, Eigenheimzulage und was es dergleichen einmal gab. Das hat man auf die Hand bekommen. Ähnlich wie jetzt das ‚Hessengeld‘“.
Die KfW-Programme, vor allem „Jung kauft Alt“, seien „Totgeburten“ und Schwellenhaushalten damit nicht geholfen. „Sie fördern letztlich Energieeffizienz und nicht den Erwerb von Wohneigentum.“ Was er überdies im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung vermisse – „dass man die Grunderwerbssteuer senken will“. Das habe man offensichtlich wieder aufgegeben. „Natürlich wäre das ein ganz großer Schritt. Weil man jedem, der ein Haus oder eine Wohnung kaufe, bislang „ja erst mal 30.000, 40.000 oder 50.000 Euro aus der Tasche nimmt. Dann bleibt nicht mehr viel übrig an Eigenkapital“.
Finanzbildung mit Schlüsselfunktion
Der große Wunsch auch der Generation Migration nach Wohneigentum bei oft zu wenig Eigenkapital wurde in der Studie ebenfalls thematisiert. Dem fügte Katharina Senge, seit 2023 für die CDU im Berliner Abgeordnetenhaus, in der Diskussion noch einen weiteren Aspekt aus eigener Anschauung in ihrem Kiez in Berlin-Schöneberg hinzu: Gerade in der ersten und zweiten Generation der Einwanderungsfamilien seien das dafür nötige Wissen und die Netzwerke, die weiterhelfen könnten, nicht vorhanden. „Weil die Eltern hier nicht zur Schule gegangen sind, die Kinder in einer Mietwohnung aufwachsen und niemanden im Familienkreis haben, der schon Wohneigentum erworben hat.“
Im Grunde sei dies ein Bildungsthema: „Wir müssen es schaffen, dass diese Generation Migration, die hier aufwächst, in der Schule auch eine gute Finanzbildung bekommt.“ Gleichzeitig räumte sie ein: „Da haben wir in Berlin in den letzten zwei Jahrzehnten im Bildungssystem nicht gut geliefert und versuchen, das jetzt massiv zu ändern.“
In Blickrichtung Bundespolitik äußerte sie: „Berlin ist das Bundesland, wo pro Einwohner die meisten Asylanträge gestellt wurden. Das hat uns in den letzten Jahren ans Limit gebracht.“ Deshalb sei es wichtig, dass „der Wohnungsbauturbo kommt und wir dabei immer auch auf eine gute soziale Mischung achten“.
Von nichts kommt nichts
„Es hilft nichts. Wir müssen bauen – und das schneller.“ Das habe mit Investitionsentscheidungen zu tun, die sich viele jedoch weniger zutrauen angesichts krasser Teuerung in den letzten Jahren. Nicht nur beim Bauen und Wohnen, sondern in allen Lebensbereichen, befand Dr. Lars Castellucci, seit 2013 für die SPD im Bundestag und dort über mehrere Jahre Fraktionssprecher für Migration und Integration.
Bestimmten Zielgruppen könne man aufhelfen im Sinne von jung oder Familien. „Ich würde nicht sofort den Stab über ‚Jung kauft Alt‘ brechen“, ging er auf Brauns Kritik ein, „sondern parallel schauen: Was hat funktioniert? Was kann man erleichtern?“. Die Grundidee sei phantastisch. Aber es müsse dann eben auch die barrierefreie Wohnung mit Aufzug als Angebot für die Älteren geben – in seinem Wahlkreis nicht der Fall.
Aus der Not heraus geboren
Wohnen benannte er als neue soziale Frage und hierbei die Verantwortung aller Politikfelder. In diesem Zusammenhang sprach er die Themen Mindestlöhne „als untere Haltelinie“ und Tariftreue an, damit Menschen auch in die Lage versetzt werden, „sich etwas zu leisten“.
Die Generation Migration und ihre Wohnwünsche haben nach den Worten von Tarek Al-Wazir auch mit sozialer Schichtung zu tun. „Da dürfen wir uns nichts vormachen“, so der langjährige Wirtschaftsminister Hessens, gebürtig aus Offenbach, jetzt als Abgeordneter der Grünen neu im Bundestag. „Wir in Offenbach sind Deutschlands Stadt mit dem höchsten Migrantenanteil. Zwei Drittel der Einwohner haben in irgendeiner Form eine Migrationsgeschichte.“ Zugleich sei es die Stadt mit der geringsten Kaufkraft in Deutschland: „Hier treffen sozusagen Gelsenkirchen-Löhne auf Frankfurt-Mieten.“ Auch aus den hohen Mieten entstehe der Wunsch der Generation Migration nach Wohneigentum sowie – „auch da wollen wir uns nichts vormachen – aus der Diskriminierung auf dem Mietwohnungsmarkt“.
Das „Hessengeld“ sehe er kritisch, so Tarek Al-Wazir in Erwiderung auf Reiner Braun und unter Verweis auf das unter seiner Ägide eingeführte Hessendarlehen. „Das hatte Einkommensgrenzen.“ Das Problem einer pauschalen Förderung sei die „Masse an Mitnahmeeffekten“. Und Geld werde nicht unendlich vorhanden sein. So dass man sich genau überlegen müsse: Wo lenkt man es hin?




