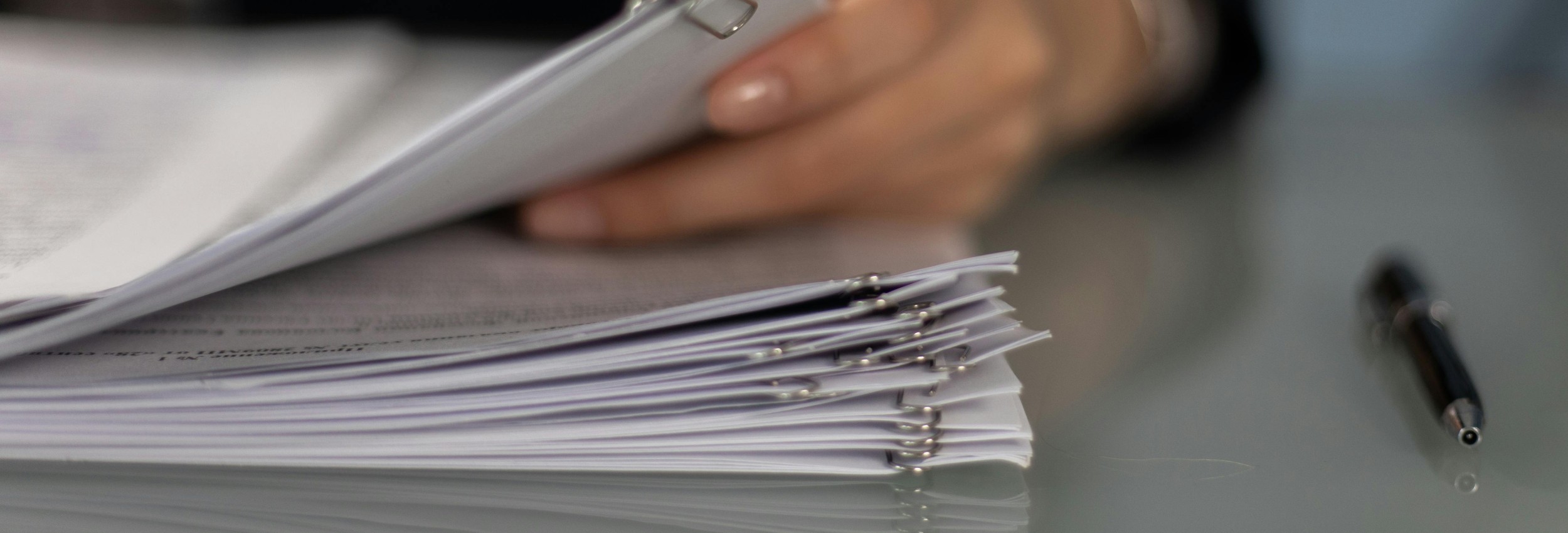Wenn Sie künftig neue Pressemitteilungen automatisch und kostenlos per E-Mail erhalten möchten, senden Sie uns bitte folgende Angaben.
26. Mai 2025
Wechsel im Vorstand des Verbands der Privaten Bausparkassen: Dirk Botzem folgt auf Jörg Phlippen
Mehr erfahren21. Mai 2025
Frühjahrsumfrage 2025: Altersvorsorge mit Abstand wichtigstes Sparmotiv, aber Immobilien und Konsum kommen zurück
Mehr erfahren19. Mai 2025
„Integration braucht ein Zuhause“ – Verband der Privaten Bausparkassen veröffentlicht Trendpapier zur Generation Migration
Mehr erfahren14. Januar 2025
Top-Finanzierer des privaten Wohnungsbaus – Historischer Rückgang bei der privaten Wohnungsbaufinanzierung im Jahr 2023
Mehr erfahren3. Dezember 2024
Herbstumfrage 2024: Sparmotiv Wohneigentum – Klarer Auftrag an die Politik
Mehr erfahren30. September 2024
Bausparkassen zur Reform der geförderten privaten Altersvorsorge: selbstgenutztes Wohneigentum bleibt fester Bestandteil
Mehr erfahren17. November 2023
Arbeitnehmer-Sparzulage: Einkommensgrenzen werden ab 2024 mehr als verdoppelt
Mehr erfahren16. November 2023
„Ampel“ muss Wohneigentumspolitik voranbringen – Bauspartag der deutschen Bausparkassen
Mehr erfahren6. November 2023
Sparmotiv „Wohneigentum“ vor „Konsum“ auf Platz 2 – Herbstumfrage 2023 der privaten Bausparkassen
Mehr erfahren17. Juli 2023
Konsum als Sparmotiv auf niedrigstem Stand seit 2000 – Sommerumfrage 2023 der privaten Bausparkassen –
Mehr erfahren17. April 2023
Konsum fast so wichtig wie Altersvorsorge – Frühjahrsumfrage 2023 der privaten Bausparkassen
Mehr erfahren30. Januar 2023
Wissenschaftspreis der privaten Bausparkassen für Nachwuchswissenschaftler – Teilnahme jetzt möglich
Mehr erfahren22. November 2022
Hohe Inflation: Können Alltagskosten gedeckt werden? – Umfrage zeigt zwiespältiges Bild
Mehr erfahren16. November 2022
Rekordinflation und Bauzinsen bestimmen Sparmotive – Herbstumfrage 2022 der privaten Bausparkassen
Mehr erfahren28. September 2022
Wohneigentumspolitik als sozialer Auftrag – Bauspartag der privaten Bausparkassen
Mehr erfahren12. Juli 2022
Weniger als 40 Prozent können sparen – Sommerumfrage 2022 der privaten Bausparkassen
Mehr erfahren25. Mai 2022
Ohne Bauwende keine Klimawende -Trendstudie zum Thema „Klimaneutralität bis 2045 – Wie werden wir in Zukunft bauen und wohnen?“
Mehr erfahren11. April 2022
Sparmotiv Wohneigentum legt deutlich zu – Frühjahrsumfrage 2022 der privaten Bausparkassen
Mehr erfahren4. April 2022
Verband der Privaten Bausparkassen unterzeichnet Absichtserklärung des UN-Umweltprogramms
Mehr erfahren25. November 2021
Koalitionsvertrag: Bausparkassenverbände vermissen Wohneigentum in der geplanten Reform der privaten Altersvorsorge
Mehr erfahren22. November 2021
Altersvorsorge-Sparen wieder hoch im Kurs – Herbstumfrage 2021 der privaten Bausparkassen
Mehr erfahren25. Oktober 2021
Selbständigkeit in Deutschland Forderungen aus Sicht der Selbständigen im Vertrieb
Mehr erfahren16. August 2021
Die Tesla-Gigafactory in der Hauptstadtregion: Neue Fallstudie beschreibt die Folgen für Wohnen und Infrastruktur in Berlin-Brandenburg
Mehr erfahren6. Juli 2021
Corona-Lockerungen lösen Konsum-Lust aus – Sommerumfrage 2021 zu Sparmotiven –
Mehr erfahren12. Mai 2021
Wie und wo wollen junge Menschen wohnen und leben? – Umfrage unter 14- bis 19-Jährigen zeigt überraschende Trends
Mehr erfahren5. Mai 2021
Diskussion mit Vertretern der Nachwuchsorganisationen von FDP, Grünen, SPD und Union
Mehr erfahren19. April 2021
Sparmotiv Wohneigentum legt weiter zu – Frühjahrsumfrage 2021 der privaten Bausparkassen
Mehr erfahren15. April 2021
Positionspapier zur sozialen Absicherung von Selbständigen und geplanten Vereinfachung des Statusfeststellungsverfahrens
Mehr erfahren14. April 2021
Einerseits mehr sparen – andererseits von Ersparnissen leben müssen – Zweigeteiltes Bild zum Sparen während des Lockdowns
Mehr erfahren6. April 2021
Repräsentative Umfrage: Corona verstärkt den Wunsch nach eigenen vier Wänden
Mehr erfahren1. März 2021
Mietkaufmodell mit existierenden Sparförderungen kombinieren – Innovatives Modell mit Optimierungspotenzial
Mehr erfahren24. Februar 2021
Wissenschaftspreis der privaten Bausparkassen – Chance für Nachwuchswissenschaftler
Mehr erfahren23. Dezember 2020
Gemeinsame Vorschläge der Bausparkassenverbände vom 23. Dezember 2020 zur Aktualisierung der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz für Bausparkassen
Mehr erfahren13. Juli 2020
Gemeinsames Papier zur Vorsorgepflicht für Selbständige und zu Corona-Soforthilfen
Mehr erfahren6. Juli 2020
Verbraucherfrust in Corona-Zeiten – Sparmotiv Konsum fällt auf 20-Jahres-Tief
Mehr erfahren18. Juni 2020
30 Jahre Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion – Verbandsbroschüre erinnert an historisches Datum
Mehr erfahren14. April 2020
Mini-Zinsen verändern Sparmotive – Frühjahrsumfrage 2020 der privaten Bausparkassen
Mehr erfahren6. April 2020
Top 10-Geldanlagen der Bundesbürger 2020, Sparer schichten um – Sparbuch großer Verlierer
Mehr erfahren27. März 2020
Unverständliche Vorschläge der Rentenkommission zur privaten Altersvorsorge
Mehr erfahren29. November 2019
Wohnungsbauprämie verbessert – Starkes Signal für die Wohneigentumsbildung – Statement zur heutigen Entscheidung des Bundesrats
Mehr erfahren19. November 2019
Fünf-Punkte-Plan zur Stärkung der privaten Altersvorsorge – gemeinsamer Vorschlag von Versicherern, Fondsindustrie und Bausparkassen
Mehr erfahren11. November 2019
„Normalisierung beim Sparen für Wohneigentum“ Herbstumfrage 2019 der privaten Bausparkassen
Mehr erfahren4. Oktober 2019
Position paper on the EBA Consultation Paper Draft Guidelines on loan origination and monitoring EBA / CP/ 2019 / 04
Mehr erfahren2. Oktober 2019
Entwurf eines Gesetzes über die Verteilung der Maklerkosten bei der Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser
Mehr erfahren24. Juli 2019
Warnsignal für die Wohnungspolitik – Sommerumfrage 2019 der privaten Bausparkassen
Mehr erfahren12. Februar 2019
Wissenschaftspreis der privaten Bausparkassen – Chance für Nachwuchswissenschaftler
Mehr erfahren5. Dezember 2018
„Die Mär von viel zu vielen Eigenheimen auf dem Land“ – Qualitative Zusatznachfrage relativiert angeblichen Überhang in Schrumpfungsregionen. Gründe für Neubau trotz Leerständen
Mehr erfahren15. November 2018
Herbstumfrage 2018 der privaten Bausparkassen: „Neue Hoffnung bei bauwilligen Sparern“
Mehr erfahren16. Juli 2018
Sommerumfrage 2018 zum Sparverhalten der Deutschen – Immobilienpreise „Stimmungskiller“ für Sparmotiv Wohneigentum
Mehr erfahren2. Mai 2018
Verband der Privaten Bausparkassen mit neuer Führung
Hertweck übernimmt von Zehnder das Amt des Vorstandsvorsitzenden Weitere Vorstandsmitglieder wiedergewählt König wird neuer Hauptgeschäftsführer Der Verband der Privaten Bausparkassen hat mit einer neuen Führung einen Generationswechsel vollzogen. Zum Vorstandsvorsitzenden des Verbands wählte die Mitgliederversammlung Bernd Hertweck (50), den Vorstandsvorsitzenden der Wüstenrot Bausparkasse AG. Er löste in diesem Amt Andreas...
Mehr erfahren17. April 2018
Frühjahrsumfrage 2018 der privaten Bausparkassen: Immobilienpreise schwächen Sparmotiv Wohneigentum
Mehr erfahren9. April 2018
Top 10-Geldanlagen der Bundesbürger 2018 – Girokonto erstmals beliebteste Geldanlage
Mehr erfahren16. November 2017
Herbstumfrage 2017 der privaten Bausparkassen: Sparneigung sinkt auf breiter Front
Mehr erfahren12. Juli 2017
Sommerumfrage 2017 zum Sparverhalten der Deutschen „Vorsorgen statt Konsumieren“ Lust am Wohneigentum nimmt weiter zu
Mehr erfahren25. April 2017
Frühjahrsumfrage 2017 der privaten Bausparkassen: Verstärkter Eigenkapitalaufbau als Reaktion auf steigende Immobilienpreise
Mehr erfahren11. April 2017
Top 10-Geldanlagen der Bundesbürger 2017 – Sparer reagieren auf Nullzinspolitik – Das Girokonto ist der Renner
Mehr erfahren30. März 2017
Private Bausparkassen: Fokussierung auf Finanzierungstarife – Zweck des Bausparens bleibt attraktiv
Mehr erfahren28. November 2016
Herbstumfrage 2016 der privaten Bausparkassen: Galoppierende Immobilienpreise als Motivationsbremse für Sparziel Wohneigentum
Mehr erfahren4. Juli 2016
Sommerumfrage 2016 des Verbandes der Privaten Bauparkassen: Unsicherheit der Sparer wächst – Zehnder warnt vor möglichen politischen Folgen der Nullzinspolitik –
Mehr erfahren26. April 2016
Die EZB und die „halbe Wahrheit“ – Ifo-Institut bestätigt schleichenden Vermögensverlust für Sparer
Mehr erfahren11. April 2016
Wohn-Riester stark nachgefragt – Nullzinspolitik verlangt Debatte über Sparanreize
Mehr erfahren18. Dezember 2015
Erklärung des Verbands der Privaten Bausparkassen zur heutigen Zustimmung des Bundesrats zum Bausparkassengesetz
Mehr erfahren18. November 2015
Herbstumfrage 2015 der privaten Bausparkassen: Andauernde Nullzinspolitik der EZB gefährdet Sparbereitschaft
Mehr erfahren8. Juli 2015
Sommerumfrage 2015 des Verbandes der Privaten Bauparkassen: Griechenland-Debatte verunsichert Sparer
Mehr erfahren7. April 2015
Frühjahrsumfrage 2015 des Verbandes der Privaten Bauparkassen: Deutsche sparen noch kurzfristiger und vor allem für Konsum
Mehr erfahren24. März 2015
Wohn-Riester bleibt Motor der Riester-Rente – Anteil am Bestandszuwachs liegt bei 75 Prozent
Mehr erfahren1. Dezember 2014
Herbstumfrage 2014 der privaten Bausparkassen: „Angst-Sparen“ statt „Lust-Sparen“
Mehr erfahren16. September 2014
Zehnder als Geschäftsführender Direktor der Europäischen Bausparkassenvereinigung wiedergewählt
Mehr erfahren9. Juli 2014
Sommerumfrage 2014 der privaten Bausparkassen: „Sparlust leidet“ – EZB fördert Mentalität „Von der Hand in den Mund leben“
Mehr erfahren7. April 2014
Frühjahrsumfrage 2014 der privaten Bausparkassen: „Ungebrochene Sparlaune“- Aber geänderte Vorlieben bei der Geldanlage
Mehr erfahren26. März 2014
20 Jahre Berufsbildungswerk der Bausparkassen – Öffnung für externe Kreditvermittler als Option
Mehr erfahren19. Dezember 2013
Energetisch sanieren bei unterschiedlichen Budgets -Studie liefert erstmals Orientierung
Mehr erfahren20. November 2013
Herbstumfrage 2013 der privaten Bausparkassen: „Altersvorsorge“ wieder wichtigstes Sparziel – Vorsorge-Sparer ohne Alternative
Mehr erfahren31. Oktober 2013
Bausparkassen bleiben zukunftssicher – Verband der Privaten Bausparkassen begrüßt Hinweise der BaFin zu Nebenwirkungen der EZB-Politik
Mehr erfahren3. Juli 2013
Sommerumfrage 2013 der privaten Bausparkassen: Sparziele „Konsum“ und „Altersvorsorge“ fast gleichauf an der Spitze – Anteil der Sparer gestiegen
Mehr erfahren6. Juni 2013
Private Bausparkassen begrüßen Vermittlungsergebnis zum Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz
Mehr erfahren4. April 2013
Frühjahrsumfrage 2013 der privaten Bausparkassen: Sparziel „Wohneigentum“ mit kräftigem Zuwachs | Anteil der Sparer sinkt nochmals
Mehr erfahren30. Januar 2013
Private Bausparkassen mit solidem Wachstum Zweitbestes Ergebnis in der Verbandsgeschichte | Rekord beim Spargeldeingang | Auch Baugeldauszahlungen gesteigert
Mehr erfahren11. Juli 2012
Sommerumfrage 2012 der privaten Bausparkassen: Sparziel „Altersvorsorge“ wieder Nr. 1 Sparneigung steigt
Mehr erfahren16. April 2012
Frühjahrsumfrage 2012 der privaten Bausparkassen: Sparziel „Konsum“ erreicht Spitzenposition Sparneigung sinkt
Mehr erfahren30. Januar 2012
Private Bausparkassen mit deutlichem Neugeschäftsplus – Marktanteil gesteigert
Mehr erfahrenFalls Sie keine Pressemitteilungen mehr erhalten möchten, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse an und klicken auf „Abmelden“.
Pressekontakt